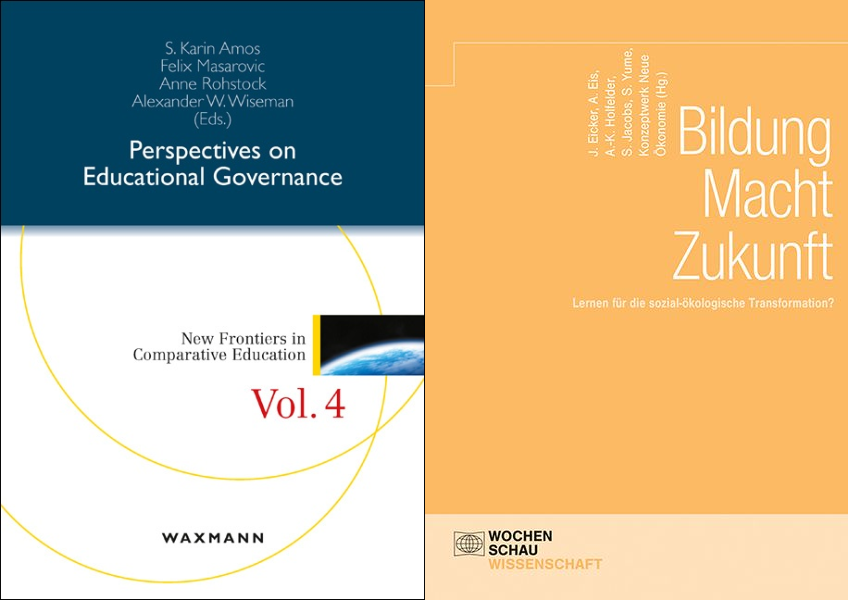In erziehungswissenschaftlichen Artikeln setze ich mich kritisch mit allgemein- und schulpädagogischen Fragen auseinander. Meine Themen sind Bildung für nachhaltige Entwicklung, Educational Governance, Schulnetzwerke und Schulentwicklung. Mich beschäftigen schwerpunktmäßig Fragen des (neoliberalen) Regierens aus gouvernementaler Perspektive sowie nach der Öffentlichkeit und Demokratisierung von schulischer Bildung im Paradigma Neuer Steuerung.
Artikel „Bildung. Macht. Subjekte. Nachhaltiges Regieren durch BNE?“
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) wurzelt im Nachhaltigkeitsdiskurs und ist wesentlicher Bestandteil der Agenda 21. Diese setzt zur Realisierung nachhaltiger Entwicklung maßgeblich auf die Eigeninitiative von Einzelnen. Studien der Green Governmentality decken nachhaltiges Handeln im Zuge dieser Verantwortungszuweisung als Ausdruck einer Form des Regierens auf, die sich durch die Selbststeuerung der als nachhaltige Konsumentinnen konstituierten Subjekte auszeichnet. Der Artikel zeigt aus gouvernementaler Perspektive, dass auch BNE im Kontext einer Gouvernementalität der nachhaltigen Entwicklung steht. Sie regiert Schülerinnen nachhaltig, indem sie ideale Lernende als verantwortungs-, handlungsfähige, gestaltungskompetente und ressourcenschonend konsumierende Beitragende zur nachhaltigen Entwicklung positioniert. Damit (re-)produziert BNE bestehende Herrschaftsverhältnisse und ist nachhaltigkeitsstrategisch defizitär ausgerichtet.
erschienen im Sammelband „Bildung Macht Zukunft. Lernen für die sozial-ökologische Transformation?“ (2020)
Vielfältige Krisenprozesse machen deutlich, dass die Rückkehr zur gewohnten Tagesordnung keine Zukunft hat. Gegen die Rede von Alternativlosigkeit werden Forderungen nach einer breiten sozial-ökologischen Transformation laut, bei der die Frage nach einem guten Leben für alle im Mittelpunkt steht. Welche Rolle kann und sollte Bildung dabei spielen? Nicht selten wird sich von Bildung eine Krisenbewältigung versprochen. Dabei ist auch Bildung in jene Macht- und Herrschaftsverhältnisse verstrickt, die in die Krise geführt haben. Der vorliegende Band diskutiert Möglichkeiten und Grenzen einer kritischen transformativen Bildung aus Perspektiven von Bildungspraxis, Wissenschaft und sozialen Bewegungen.
Artikel „Problem Schulabsentismus: Wie können schulabsente Lernende während des Fern- und Wechselunterrichts erreicht werden?“
Schon vor der Corona-Pandemie blieben manche Kinder und Jugendliche der Schule fern: Schulabsentismus ist kein neues Problem. In Zeiten von Fern- und Wechselunterricht hat es jedoch zugenommen und sich auch verschärft. Einige Lernende waren gar nicht mehr erreichbar. In diesem Text wird die Problematik skizziert und es werden Lösungsversuche erarbeitet.
Artikel „Public Matters? PISA’s ‚Philosophy of Governance“ in Comparison to John Dewey’s Conception of the Public’
The Programme for International Assessment (PISA) is regarded as the most influential international achievement measurement (Langfeldt, 2007, p. 225) and is an important component of current international educational reforms. In the German context, several authors consider John Dewey and the American Pragmatism as PISA’s background philosophy (Bellmann, 2007, p. 423). Bellmann (2007) rejects this assumption but suggests illuminating the current educational reforms’ backgrounds by comparing it with Dewey’s conceptions.
The OECD and PISA study rely on governance by data and evidence parallel to current reforms that are characterized by an “alliance” (ibid., p. 424) between scientific analysis and political intervention the OECD and PISA study rely on. The PISA study is the most prominent example of the OECD’s Evidence Agenda, which manifests itself in the term of the evidence-informed policy research (EIRP) reform strategy (Forster, 2014, p. 897). In order to better understand and reflect PISA’s ‘philosophy of governance’ in terms of its public character I draw on Dewey’s (1927/2016) conception of the public. In comparison to Dewey’s conception of an active, communicative and critical socially inquiring public the OECD’s and PISA’s ‘philosophy of governance’ emerges as technocratic and elitist democratic. In this context educational research impends to become a means of control.
erschienen im Sammelband „Perspectives on Educational Governance“ (2022)
In March 2019, students and researchers from Germany, the USA, China, Kenya and South Africa came together at the University of Tuebingen to discuss Educational Governance from an international perspective. The group was mainly comprised of Ph.D.- and Master-students from various disciplines – Education, Literature, Philosophy, Political Science – and debated questions such as: What are the distinctive and different rationales underlying the discourse of Educational Governance and its political, economic, academic and pedagogic objectives? How can we make these rationales visible and which theories and analytic tools can help us to decipher the meanings attached to them? Are there different local and national trajectories in education discourse and practice with regard to Educational Governance and which role do international organizations and transnational transfer play? This edited volume displays these discussions and aims at initiating a broader communication about Educational Governance between previously separated spaces.